Dekalog/Die zehn Gebote
Name
Der Name Dekalog stammt aus dem griechischen Text von Ex 34,28, übersetzt lautet er: Zehnwort. Als Dekaloge im engeren Sinne gelten die beiden Reihungen Ex 20,1-17 und Dtn 5,6-21. Daneben finden sich innerhalb des AT noch weitere Reihungen von Rechtssätzen. Der jüdischen Tradition nach gibt es insgesamt 613 Ge- und Verbote in der Tora.
Die Zehn Gebote
Stil
Besonderes Kennzeichen der Rechtssätze ist der sogenannte apodiktische Stil (A. Alt) nach dem Muster „Du sollst/wirst (nicht)“ als absolute Formulierung ohne Angabe eines genauen Fallbeispiels oder einer Strafandrohung. [Gegenteil: kasuistischer Rechtssatz, bei dem ein konkreter Kasus samt Strafe geschildert wird: „...wenn einer das und das tut, dann soll ihm das und das geschehen“ (vgl. Ex 21,28-32)]. Die Anordnung von Geboten in 5er oder 10er-Reihen geschah wohl, um das Abzählen und so das Merken zu erleichtern (Mnemotechnik).
Schaden durch Tiere – Verlust von Tieren
Alter
| Ex 20,1-17: | Dekalog I |
| Dtn 5,6-21: | Dekalog II |
| Ex 23,10-19: | Vorform zum kultischen Dekalog; Privilegrecht JHWHs |
| Ex 34,10-26( 28): | Kultischer Dekalog |
| Dtn 27,15-26: | Fluchformeln für Verbrechen, die im Verborgenen geschehen (12 Sätze) |
| Lev 18,6-24: | Ehe-/Reinheitsgesetze |
| Lev 19,3-12. 13-18: |
Kultische Vorschriften |
| Hos 4,2 und Jer 7,9: | Vorstufen des Dekalogs (oder Anspielungen?) |
An den parallel überlieferten Reihen von anderen Rechtssätzen ist ablesbar, dass die beiden klassischen Dekaloge offensichtlich spätere Bildungen sind, die das Bestreben haben, das gesamte Verhältnis zwischen Gott und Menschen/Israel umfassend zu ordnen. Die älteren Reihen beziehen sich dagegen auf Einzelaspekte (Reinheit, Kultus etc.). Dabei können einzelne Gebote durchaus älter als die Gesamtkomposition sein. Nach Ps 50,7 und 81,9-11 wurden Dekaloge wohl bei kultischen Begehungen rezitiert. Eine Vorform der Selbstvorstellungsformel „Ich bin der Herr“ findet sich in Hos 13,4.
Theologie
| Römisch-katholisch/Lutherisch | Jüdisch | Reformiert |
| 1. | Selbstvorstellung Gottes, Ex 20,2/Dtn 5,6 | Jüd: 1., | Ref: 1. |
| Fremdgötterverbot, Ex 20,3/Dtn 5,7 | Jüd: 2., | Ref: 1. | |
| Bilderverbot, Ex 20,4-6/Dtn 5,8-10 | Jüd: 2., | Ref: 2. | |
| 2. | Mißbrauch des Gottesnamens, Ex 20,7/Dtn 5,11 | 3. | |
| 3. | Sabbatheiligung, Ex 20,8-11/Dtn 5,12-15 | 4. | |
| 4. | Elterngebot, Ex 20,12/Dtn 5,16 | 5. | |
| 5. | Verbot des Tötens, Ex 20,13/Dtn 5,17 | 6. | |
| 6. | Verbot des Ehebruchs, Ex 20,14/Dtn 5,18 | 7. | |
| 7. | Verbot des Stehlens, Ex 20,15/Dtn 5,19 | 8. | |
| 8. | Verbot der falschen Aussage, Ex 20,16/Dtn 5,20 | 9. | |
| 9. | Verbot des Begehrens des Hauses, Ex 20,17a/Dtn 5,21a | 10. | |
| 10. | Verbot des Begehrens von Frau+Sklaven, Ex 20,17b/Dtn 5,21b | 10. |
Der Dekalog als Zusammenfassung des göttlichen Willens setzt voraus, dass Gottes Heilstat vor allem menschlichen Antworthandeln geschehen ist; dogmatisch gesprochen: Auf das Evangelium antwortet der Mensch mit der Einhaltung des Gesetze; er tut nur das, was dem Heilshandeln Gottes entspricht. Negativ formulierte Sätze markieren dann die Grenze, hinter der ein bundesgemäßes Leben nicht mehr möglich ist. Die Dekaloge sichern so die Ordnung des Bundes und auf diese Weise ein heilvolles Leben.
Doppelüberlieferung des Dekalogs
Die Doppelüberlieferung des klassischen Dekalogs in Ex 20 und Dtn 5 ist bemerkenswert, weil es zwischen den beiden Versionen ca. 20 Differenzen gibt. Dabei bietet die Dtn-Fassung 13 Erweiterungen, so dass sie wohl als die jüngere Version anzusehen ist. Insgesamt scheint das ganze Buch Deuteronomium den Dekalog auslegen zu wollen. Die einzelnen Abweichungen wie der ursprüngliche Sinn der Einzelgebote sind nicht Gegenstand der Bibelkunde, dazu vgl. die Sekundärliteratur.
Wiederholung der Zehn Gebote
Mose als Mittler zwischen Gott und Israel
Die Zehn Gebote
Kapitel 20,22–23,19
Das Altargesetz
Zählungsunterschiede
Im Judentum gilt der erste Satz des Dekalogs nicht als eine Glaubensaussage, sondern als besonderes, erstes Gebot, an Gottes Existenz zu glauben; daher die abweichende Zählung. Die orthodoxe und reformierte Tradition begreift Fremdgötter- und Bilderverbot als getrennte Sätze. Jüdische und orthodoxe/reformierte Tradition differenzieren nicht mehr beim Gebot des Begehrens, so erreichen auch sie die Zehnzahl. Lernstoff ist in jedem Falle die Zählung der Einzelgebote, hier nach der römisch-katholischen und lutherischen Ordnung.
Bundestafeln
Nach Dtn 5,22 werden die Gebote auf die beiden Tafeln verteilt, die Mose laut Ex 32,15f./34,1.29 auf dem Gottesberg erhalten hat. Im Exodus-Text gibt es jedoch keinen Anhalt für die Verbindung von Bundestafeln und Dekalog. Nach 1Kön 8,9 wurden diese beiden Bundestafeln in der Lade im Tempel aufbewahrt.
Der Glanz auf Moses Angesicht
Neue Gesetzestafeln. Bundesschluss und Bundespflichten
Mose kehrt zurück
Literatur
F. L. Hossfeld, K. Berger, Art. Dekalog, NBL I, 1991, S. 400-405.
W. H. Schmidt u. a., Die Zehn Gebote, EdF 281, 1993.
M. Köckert, Art. Dekalog/Zehn Gebote
Digitale Bibelkunde
Zur Übersicht der Themenkapitel Die Texte auf dieser Seite sind mit freundlicher Genehmigung übernommen aus: Rösel, Martin: Bibelkunde des Alten Testaments. Die kanonischen und apokryphen Schriften. Mit Lernübersichten von Dirk Schwiderski, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 11., veränd. Aufl. 2021. Zur Vorbereitung auf die Bibelkunde-Prüfung: Die Lernkartensets zur Bibelkunde für Repetico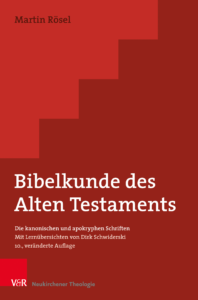
Die ideale Ergänzung
